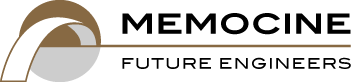Das Krisen-ABC: Kritische Begriffe, die jeder kennen sollte
Krisenkommunikation ist ein anspruchsvolles Handwerk. Sie erfordert klare Strategien, Haltung und Vorbereitung. Dazu gehört auch das Wissen über fachspezifische Termini.
Alarmplan
Ein funktionierender Alarmplan ist das Rückgrat jeder raschen und koordinierten Krisenreaktion. Er regelt, wer wen, wann und wie im Ernstfall kontaktiert. Alarmpläne und die Erreichbarkeit des Krisenteams sollten regelmäßig getestet werden. Ein Alarmplan definiert regelmäßig Eskalations- bzw. Alarmstufen.
Anfälligkeit
Grad der Verwundbarkeit bzw. Vulnerabilität eines Systems oder einer Organisation gegenüber potentiellen Störungen.
Angst
Angst ist eine emotionale Reaktion auf eine empfundene Bedrohung oder Unsicherheit. Sie ist ein natürlicher Schutzmechanismus, kann in Krisensituationen aber auch zu einem kritischen Risikofaktor werden, wenn sie lähmt, irrational wird oder sich kollektiv ausbreitet. Führungskräfte sollten nicht nur ihre eigenen Ängste z.B. mit Hilfe eines psychologischen Notfallkoffers managen, sondern auch immer einen Blick für ihr Team und andere Stakeholder haben und diese soweit wie möglich unterstützen.
Antifragilität
Fähigkeit eines Systems, unter Stress, Unsicherheit oder Schocks nicht nur stabil zu bleiben, sondern sich weiterzuentwickeln und stärker zu werden.
Blackout
Währen das Wort „black out“ für abschalten (insbesondere des Stromnetzes) steht und einen eher kurzfristigen Ausfall beschreibt, verbinden wir mit dem Wort „Kollaps“ den totalen Zusammenbruch eines Systems mit all seinen Prozessen und Strukturen. Ursachen für den Kollaps von Unternehmen sind strategische Fehlentscheidungen, finanzielle Probleme, operative Schwächen (z.B. Personalmangel, Lieferkettenprobleme), Management- und Führungsfehler, Vertrauensverlust und Reputationsschäden sowie die Folgen externer Schocks (z.B. Pandemien, Extremwetterfolgen, technologische Disruption und politische Instabilitäten, Kriege und vieles mehr).
Black Swan
Unerwartetes, extrem seltenes Ereignis mit massiver Auswirkung, das erst im Nachhinein als erklärbar erscheint.
Blaulicht-Reporter
Medienschaffende, die sich auf die Berichterstattung von Unglücksereigissen spezialisiert haben.
Business Continuity Management (BCM)
Aufrechterhaltung kritischer Geschäftsprozesse unter Zuhilfenahme der dafür notwendigen Maßnahmen. In Krisensituationen muss das Management klare Prioritäten setzen. Ziel des BCM ist die Existenzsicherung der Organisation.
Crisis Fatigue
Erschöpfung durch anhaltende Krisensituationen.
Crisis Mapping
Visualisierung von Krisenverläufen und deren Akteuren mit Hilfe von Karten. Etwa 80% aller menschlichen Entscheidungen haben einen räumlichen Bezug. In Krisen kommt der Lokalisation eine noch sehr viel höhere Bedeutung bei wie z.B. bei der Suche nach Opfern oder dem Erkennen kritischer Räume, über den sich ein Ereignis ausbreiten könnte. Diesem Ziel steht die häufig mangelhaft zur Verfügung stehende Datenbasis entgegegen.
Cascading Effect
Dominoeffekt von Krisen auf andere Systeme.
Cyberangriff
Ein Cyberangriff steht für den Versuch, unerlaubt von außen Zugriff auf eine IT-Infrastruktur zu gelangen. Cyberangriffe legen systematische Mängel bei der IT-Sicherheit offen: entweder durch Sicherheitslücken oder auch durch menschliches Versagen.
Dark Site
Eine Dark Site ist eine vorbereitete Krisenwebseite, die im Notfall aktiviert wird. Die Seite sollte neutral gestaltet, aber mit wenigen Klicks redaktionell anpassbar sein.
Debriefing
Nachbereitung im Team zur Analyse und Verarbeitung eines Issues.
Deeskalationsstrategie
Taktiken zur Entschärfung emotionaler Lagen.
Dual Use Problematik
Zivile und eventuell ursprünglich für friedliche Zwecke vorgesehene Produkte und Dienstleistungen können in den falschen Händen missbraucht werden und eine Sicherheitsgefahr für die Allgemeinheit darstellen.
Eskalationsstufen
Nicht jeder Vorfall ist automatisch eine Krise. Eskalationsstufen helfen, Struktur und Verantwortlichkeiten bei wachsender Dringlichkeit zu wahren.
Eskalierendes Commitment
Ein auf kognitiver Verzerrung basierendes Verhalten, bei dem eine in der Vergangenheit getroffene Fehlentscheidung aufrechterhalten und gerechtfertigt wird, indem weitere Ressourcen nachgeschossen werden. Im Börsenjargon heißt es dann: “Dem schlechten Geld wird gutes hinterhergeworfen.”
Ethik
Der moralische Kompass bei kritischen Entscheidungen und in der Kommunikation. In Krisen steht oft nicht nur das Unternehmen, sondern auch seine Glaubwürdigkeit, Integrität und Menschlichkeit auf dem Prüfstand. Entscheidungen, die nur technisch oder taktisch getroffen werden, aber ethische Grundsätze verletzen, können langfristig mehr Schaden als Nutzen verursachen. Wiederkehrende ethische Spannungsfelder in der Krise sind: Wahrheit versus Image, Eigenschutz versus Gemeinwohl, Pflicht versus Mitgefühl sowie Opfer versus Verantwortung.
Fake News
Fake News sind falsch konstruierte oder irreführende Informationen. Sie werden vorsätzlich über Medienkanäle gestreut, um eine öffentliche Meinung zu manipulieren. Das Zusammenspiel sozialer Medien und KI hat das Risiko von Fake News signifikant erhöht. Daher gehören Faktenchecks zu den Instrumenten jeder Krisenkommunikation.
Faktencheck
Überprüfung der Informationslage vor jeder Mitteilung. Daraus leitet sich einer der obersten Grundsätze für die Krisenkommunikation ab: „Erst prüfen, dann sprechen.“ Für eine professionelle Krisenkommunikation verbietet es sich, an Spekulationen teilzunehmen oder diese sogar zu befeuern. Instrumente eines Faktenchecks sind Quellenprüfungen, das Vier-Augen-Prinzip, Faktenfreigabe durch Fachexperten, Bildrückwärtssuche (um z.B. mögliche Deepfakes aufzudecken, d.h. digitale Fälschungen, die nur schwer vom Original zu unterscheiden sind) und auch der Rückgriff auf Faktencheck-Experten wie z.B. Correctiv, dpa, Tagesschau-Faktencheck.
Fünf-Finger-Methode
Die Fünf-Finger-Methode zur Entscheidungsstrukturierung in Notfällen ist ein einfaches, handlungsorientiertes Modell, das hilft, unter Zeitdruck und Stress systematisch vorzugehen und schnell tragfähige Entscheidungen zu treffen. Sie ordnet das Handeln anhand fünf zentraler Leitfragen:
-
Sicherheit: Besteht akute Gefahr für mich oder andere?
-
Lage: Was ist konkret passiert und wer ist betroffen?
-
Priorität: Was ist jetzt am dringendsten zu tun?
-
Hilfe: Welche Unterstützung und Ressourcen stehen zur Verfügung?
-
Handlung: Was ist der nächste konkrete Schritt?
Ziel der Methode ist es, Überforderung zu reduzieren, Prioritäten klar zu setzen und sofort handlungsfähig zu bleiben.
GAU
Größter Anzunehmender Unfall, der nicht mehr beherrschbar ist. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl und der damit verbundenen Kernschmelze am 26. April 1986 gilt als Super-GAU.
Gerücht
Im letzten Jahrhundert standen physische Krisen wie Brände und Explosionen an erster Stelle für die Ursachen existentieller Unternehmenskrisen. Inzwischen wurden sie abgelöst von Gerüchten, d.h. unbewiesenen, aber massenhaft verbreiteten Nachrichten, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Glaubwürdigkeit einer Person oder Organisation haben. Gerüchte breiten sich langsam wie Gift aus. In sozialen Medien kann aus einer skandalösen und emotionalisierenden Behauptung ein Shitstorm entstehen. Leider lässt sich eine einmal in der Öffentlichkeit verbreitete Verdächtigung nur schwer wieder einfangen, weil sie teils mit Tatsachen vermengt werden. Umso wichtiger ist es, so früh wie möglich eine Gegendarstellung zu kommunizieren, Unterstützer und Fürsprecher in eine sich eskalierende Diskussion einzuladen (manchmal gelingt es so, einen negativen „Shitstorm“ in einen positiven „Candystorm“ zu verwandeln) und im Sinne einer Nulltoleranzpolitik und zur Vermeidung von Wiederholungstätern auch rechtliche Schritte zu prüfen (z.B. eine Unterlassungsklage).
Goldene Stunde
Beschreibt den kritischen Zeitraum direkt nach einem Notfall, in dem schnelle, richtige Maßnahmen entscheidend sind. Was in der goldenen Stunde getan oder unterlassen wird, entscheidet über den zukünftigen Verlauf eines Notfalls bzw. einer Krise.
Heuristiken
Mentale Abkürzungen, die unter Zeitdruck helfen, Entscheidungen schnell zu treffen – in Krisen nützlich, aber zugleich fehleranfällig.
Human Touch
Gerade in Krisen wollen Menschen spüren, dass echte Menschen reagieren. Unternehmen und deren Management müssen daher auch Mitgefühl und Empathie zeigen. Ein persönliches Statement des Top-Managements sowie dessen Mimik und Stimme wirken authentischer als Zahlen und trockene Sachargumente auf einer schriftlichen Erklärung.
Humor in der Krise
Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt, ist in vielen Situationen ein unterschätztes, aber hochwirksames Mittel, um mit Ausnahmesituationen besser umzugehen. Richtig eingesetzt, kann Humor in Krisenzeiten helfen, Spannungen zu lösen, emotionale Entlastung zu schaffen und die zwischenmenschliche Kommunikation zu stärken. Mit Hilfe der Lächeltherapie aus dem psychologischen Notfallkoffer können z.B. die Betroffenen ihr eigenes Stresslevel senken. Humorvolle Übertreibungen können situativ den Konfliktparteien die Sinnlosigkeit ihres Streites vor Augen führen, um sie so an das Lösen eines Problems statt weiterer Schuldzuweisungen zu erinnern. Toxischen Kommentaren von Hatern in sozialen Netzwerken kann mit einer humorvollen Replik der Spiegel vorgehalten werden. Zynismus oder Sarkasmus sind jedoch immer dann die falschen Instrumente, wenn Menschen in Not echte Hilfe benötigen.
Impact Assessment
Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Ereignisses sowie der eigenen Handlungen.
Issue Management
Das systematische Identifizieren, Analysieren und Reagieren auf Themen im Sinne von Frühwarnsignalen. Derartige Issues bzw. Ereignisse umfassen sowohl Risiken als auch Chancen, die für ein Unternehmen in der Zukunft relevant werden könnten. Ein regelmäßiges Monitoring bzw. Themenradar bewahrt das Management vor Überraschungen und ermöglicht es, frühzeitig die Deutungshoheit über ein Issue zu gewinnen.
Jahrhundertflut
Beispiel für die oft irreführende Bezeichnung eines extrem selten auftretenden Ereignisses im Zusammenhang mit Überschwemmungen. Inzwischen hat die inflationäre Verwendung dieses Begriffes einen negativen Beigeschmack, weil sie das Ignorieren des Klimawandels und die eigene Verantwortung relativiert.
Krise
Allgemein betrachtet handelt es sich bei einer Krise um den Höhepunkt bzw. Wendepunkt einer kritischen Entwicklung, ab dem ein Weitermachen wie bislang nicht mehr möglich ist, ohne damit existentielle Gefahren bzw. den Zusammenbruch eines Systems in Kauf zu nehmen. Eine Krise kann ein Unternehmen vor unlösbare Aufgaben stellen. Das Auftreten einer Krise kann aber auch im Sinne einer Chance den Anstoß zu einer strategischen Kehrtwende und dem Einleiten eines Lern- und Transformationsprozesses liefern.
Krisenstab
Der Krisenstab ist das Führungsgremium bei schwerwiegenden Vorfällen. Rollen, Kompetenzen und Abläufe müssen vorher in einem Krisenhandbuch definiert sein. Der Krisenstab koordiniert alle Informationen und Maßnahmen des Krisenteams bzw. der Task Force regelmäßig in einem speziell ausgestatteten Krisenraum.
Kognitive Verzerrung
Psychologische Denkfehler und fehlerhafte Informationsverarbeitungen im menschlichen Gehirn. Aufgrund falscher Annnahmen und Rückschlüsse führen sie zu suboptimalen Entscheidungen und Handlungen. Bekannte Formen der kognitiven Verzerrung sind u.a. Ankerfehler, Bestätigungsfehler, Dunning-Kruger-Effekt, Framing-Effekt, Herdenverhalten, Priming-Effekt, Rückschaufehler, Truthahn-Illusion und Verlustaversion. Sie alle schwingen bei der Deutung einer Krise mit und sind von der sachlichen Berichterstattung zu trennen.
Kumulrisiko
Zusammenwirkung mehrerer Einzelrisiken zur Großkrise.
Litigation-PR
Eine spezielle Form der Krisenkommunikation, mit der die Pressearbeit vor, während und nach einem Gerichtsverfahren gemanagt wird. Früher sah man darin eine Möglichkeit, einen Einfluss auf Richter und Staatsanwälte zu nehmen, die in der Zeitung über ihr eigenes Verfahren lasen. In der Zukunft der Rechtskommunikation geht es aber sehr viel mehr darum, eine Vorverurteilung in den Medien zu vermeiden bzw. Verständnis für die eigene Position bei einer breiten Öffentlichkeit zu schaffen. Ohne Litigation-PR droht möglicherweise nach einem zivil- oder strafrechtlichen Schuldspruch zudem eine gesellschaftliche Ächtung der betroffenen Person oder auch eines Unternehmens.
Medientraining
Schulung von Personen mit Sprecherfunktion für zukünftige Krisensituationen. Dabei sollten neben Statements und dem Verfassen von Presseinformationen auch das Kommunizieren mit kritischen Stakeholdern am Telefon, auf Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen und das TV-Interview situativ trainiert werden.
Mimikry
Bewusste Anpassung der eigenen Kommunikation an die Tonalität der Zielgruppe. Der Grundsatz lautet: „Wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht.“ Unternehmen und Politiker sollten jedoch aufpassen, dass sie stets ihre eigene Souveränität bewahren und sich nicht in emotionale, unsachliche Debatten hineinziehen lassen. Überhaupt entscheidet die Angemessenheit der eigenen Körpersprache (Mimik, Gestik, Körperhaltung, Abstand und Nähe, Stimme) regelmäßig darüber, ob ein Konflikt eskaliert oder nicht.
Mobbing
Das Schikanieren, Demütigen und Ausgrenzen von Personen. Das wiederholte Mobbing eines Täters kann für das Oper erhebliche psychische, körperliche und auch soziale Folgen haben. Mobbing stellt in jedem Unternehmen ein No-Go dar und muss mit einer Nulltoleranz verfolgt werden.
Murphys Gesetz
Ein von dem amerikanischen Ingenieur Edward Murphy vereinfacht formulierte Beobachtung über das menschliche Versagen: „Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen.“ Durch seine einseitig pessimistische Sichtweise zählt Murphys Gesetz zu den kognitiven Verzerrungen und wird oft spöttisch verwendet.
Narrativ
Die erzählende Darstellung eines Vorgangs. Mit Hilfe des Narrativs werden auch komplexe Zusammenhänge erklärbar und einfacher darstellbar, weil die einzelnen Geschichtselemente scheinbar logisch miteinander verknüpft werden. In Krisen tauchen regelmäßig auch Gegennarrative auf, mit denen ein Ereignis aus einer anderen Perspektive erzählt wird.
Ostricht-Effekt
Vogel-Strauß-Taktik, bei der die Betroffenen in der Krise bzw. bei Problemen den Kopf in den Sand stecken.
Organisationsverschulden
Haftung des Managements, wenn unternehmensinterne Abläufe und Strukturen mangelhaft organisiert wurden und diese zu einem kritischen Ereignis geführt haben. Liegt eine rechtswidrige Unterlassung vor, kann die geschädigte Person einen Anspruch auf Schadensersatz geltend machen. Wer ein Unternehmen leitet, trägt die Verantwortung, dass Zuständigkeiten eindeutig festgelegt sind, Kontroll- und Aufsichtspflichten wahrgenommen werden, das Personal sorgfältig ausgewählt und geschult wird und die Reaktionen auf einen Notfall klar definiert sind und auch eingehalten werden.
Pinnacle Moment
Der kritische Moment in einer Krise, in dem sich entscheidet, ob eine Situation eskaliert oder abgefangen wird.
Prophylaxe
Ein Großteil des Krisenmanagements und der Krisenkommunikation beschäftigt sich mit dem Denken in Szenarien und der Vorbereitung auf mögliche Krisenfälle, ohne dass diese real eintreten müssen. Stattdessen geht es um Schutzmaßnahmen zur Vermeidung solcher Ereignisse und die Notfallbereitschaft, um im Falle eines Falles erfolgreich reagieren zu können.
Psychologischer Denkfehler
Unser Verstand kann uns gerade dann täuschen, wenn wir ihn am dringendsten bräuchten: in der Krise. Häufig fehlt es an Zeit, um komplexe Probleme in ihrer Gänze zu erfassen. Emotionen wie Wut, Trauer, Angst verstärken zudem das impulsive Denken und Handeln. Besonders häufig werden Krisen durch Bestätigungsfehler (Confirmation Bias) verschärft: Unser Gehirn spielt uns einen Streich, indem es gezielt nach bereits bekannten Informationen sucht, die sich mit unseren Einstellungen decken. Abweichende Informationen, die durchaus richtig sein könnten, werden herausgefiltert. Aber auch das Schwarz-Weiß-Denken, die Beschränkung auf „Entweder-oder“ statt „Sowohl-als-auch“ Lösungen treten gerade in Krisen vermehrt auf. Nach einer Krise urteilen Außenstehende einseitig über die Akteure, z.B.: „Das hätte man doch sehen müssen“ (Rückschaufehler). Schließlich wirken der unter Stress der auftretende Tunnelblick, das Groupthinking und eigene Selbstüberschätzung („ich habe alles unter Kontrolle“) wie Brandbeschleuniger.
Psychologische Notfallkoffer
Sammlung von Sofortmaßnahmen, um akute Stresssituationen effizient und effektiv behandeln zu können. Techniken wie Handakupressur, EMDS, spezielle Atemtechniken und vieles mehr kann jeder lernen und individuell zusammenstellen.
Querdenker
Ursprünglich verstand man unter einem Querdenker einen Menschen, der unkonventionell denkt. Im Zusammenhang mit der 2020 ausgebrochenen Coronakrise steht das Wort für Personen, die sich Sachargumenten entziehen und ihren Glauben teils aus Verschwörungstheorien und extremistischen Ideologien speisen. Der Versuch, Querdenker zu überzeugen, scheitert regelmäßig an deren geschlossenem Weltbild. Eine Kommunikation mit dieser Personengruppe ist oft nur dann möglich, wenn ihnen aufmerksam zugehört wird, weil sie sich generell als nicht respektiert fühlen. Erst dann kann durch Hinterfragen oder z.B. durch die Forderung nach Beweisen für die aufgestellten Thesen eventuell doch noch ein Dialog bzw. ein Umdenken eingeleitet werden.
Recovery Management (Nachsorge)
Strukturierter Prozess nach einer Krise, um Schäden zu beheben, Vertrauen wiederherzustellen und Lehren abzuleiten.
Red Flags
Red Flags sind frühe Warnsignale, die auf potenzielle Probleme, Fehlentwicklungen oder Risiken hinweisen. Sie können sich in Daten, Verhalten, Stimmungen, internen Prozessen oder externen Trends zeigen. Werden Red Flags ignoriert, steigen die Wahrscheinlichkeit und die Wucht einer späteren Krise erheblich. Typische Red Flags sind u.a.: unerklärliche KPI-Abweichungen, auffällige Stimmungsumschwünge bei Mitarbeitenden, ungewöhnliche Social-Media-Aktivitäten, erhöhte Beschwerdequoten, steigende Fluktuation oder wiederkehrende sicherheitsrelevante Störungen.
Reputationsrisiko
Gezielte Gestaltung, Pflege und der Schutz des Rufs eines Unternehmens, einer Marke oder einer Person in der Öffentlichkeit. Eine verlorene Reputation kann für die Betroffenen mit erheblichen finanziellen Folgeschäden verbunden sein. Unternehmen können das Reputationsrisiko senken, wenn sie sich für gesellschaftlich relevante Themen einsetzen (z.B. Umweltschutz, Unterstützung sozial benachteiligter Personen) und bereit sind, auch mit kritischen Stakeholdern einen nachhaltigen Dialog einzugehen.
Restrisiko
Ein verbleibendes, nicht ausschließbares Risiko, das trotz aller Sicherheits- und Vorsorgemaßnahmen bestehen bleibt. Restrisiken sind systembedingt und sagen nichts darüber aus, ob Sicherheitsmaßnahmen vernachlässigt werden.
Risikowahrnehmung
Das Erkennen und die Verarbeitung von möglichen Gefahrenquellen stellen einen kognitiven Vorgang dar, der höchst subjektiv erfolgt. So wirkt Flugangst auf die Betroffenen, obwohl Fliegen statistisch sicherer ist als Autofahren. Die Risiken des Klimawandels werden stattdessen regelmäßig unterschätzt, weil die Veränderungen erst über einen jahrelangen Prozess sichtbarer werden. Umso wichtiger sind transparente Informationen und plakatives Scientific Storytelling.
Resilienz
Psychische Widerstandskraft und Fähigkeit von Menschen, Organisationen oder Systemen, Krisen, Belastungen oder Rückschläge zu bewältigen, ohne dauerhaft Schaden zu nehmen – und idealerweise sogar gestärkt hieraus hervorzugehen.
Risikomatrix
Visualisierung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe.
Rouge Actor
Einzelpersonen, die aus Eigenmotivation heraus riskante, destruktive oder unkontrollierte Handlungen setzen und dadurch Krisen verschärfen.
SCCT
“Situational Crisis Communication Theory” nach Timothy Coombs. Sie besagt, dass Krisenmanager angemessene Krisenreaktionen auf das Ausmaß der Krisenverantwortung und die Reputationsbedrohung abstimmen sollten, die von einer Krise ausstrahlen.
Schweigespirale
Aus Angst vor sozialer Isolation schweigen Menschen lieber, statt eine unpopuläre Meinung zu äußern, was wiederum den Eindruck verstärkt, dass es keine Gegenmeinung gibt. Menschen, die von extremistischen Parteien und deren Anhängern bedroht werden, neigen zur Selbstzensur. Gerade in der Krise wenden sich aber auch bisherige Freunde, Kunde und Geschäftspartner von Unternehmen ab, wenn sie Sorge haben, „in ein fallendes Messer“ zu greifen. Unterstützung muss daher bis zu einem bestimmten Maße auch aktiv eingefordert werden.
Shadow IT
Unkontrollierte IT- oder Softwarelösungen, die an offiziellen Sicherheits- und Kommunikationsstrukturen vorbei betrieben werden und in Krisen massive Risiken erzeugen.
Shitstorm
Eine Welle, meist negativer Kritik in sozialen Medien und in der Öffentlichkeit, die sich schnell eskalierend gegen eine Person, ein Unternehmen oder eine Institution richtet. Das Gegenteil ist ein Candystorm.
Social Listening
Hinhören auf relevante Online-Diskurse.
Sprachregelung
Das A und O der Krisenkommunikation, mit der Aussagen und Kernbotschaften vom Krisenteam validiert und vereinheitlicht werden, damit die Akteure keine widersprüchlichen Botschaften senden. Im Zusammenhang mit der Unternehmenskommunikation taucht auch die Forderung nach einer einheitlichen, konsistenten One-Voice-Policy auf.
Stakeholder
Person bzw. Gruppe, die ein berechtigtes Interesse an einer Krise bzw. allgemein einem Thema hat. Die Belegschaft eines Unternehmens ist z.B. neben einer fairen Entlohnung am Erhalt ihrer Arbeitsplätze interessiert. Anwohner wollen regelmäßig ihre Autonomie bewahren („not behind my Backyard“ Haltung). Medien müssen für ihre eigene Existenzsicherung eine kritische Masse an Auflage und Reichweite erzielen. Für Wissenschaftler haben z.B. eine Anerkennung in der Scientific Community, Veröffentlichungen und die Beschaffung von Drittmittel eine hohe Bedeutung. Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wollen neben einer Umsetzung ihrer Ziele, finanzielle Unterstützung, eine Teilhabe an Entscheidungsprozessen oder den Zugang zu Informationsquellen. Last but not least haben Politiker ein Interesse daran, bei der nächsten Wahl wiedergewählt zu werden. All diese unterschiedlichen Interessen sind bei der Krisenkommunikation zu berücksichtigen und aufeinander abzustimmen.
Störfall
Beeinträchtigung des bestimmungsgerechten Betriebsablaufes eines Kraftwerkes bzw. einer technischen Anlage. Aus einem Störfall ergibt sich eine ernstzunehmende Gefahr für Lebewesen und die Umwelt.
Streisand-Effekt
Phänomen, bei dem der Versuch, eine unliebsame Kriseninformation zu unterdrücken, den gegenteiligen Effekt auslöst: maximale Aufmerksamkeit.
Tabubruch
Jede Gesellschaft und jedes Unternehmen kennt Normen, die als Basis des Miteinanders akzeptiert werden. Firmen-Tabus sind Handlungen, die aufgrund ihrer Unangemessenheit oder aufgrund eines Risikos strikt zu vermeiden sind. Beispiele sind: Kritik an Vorgesetzten und Kunden, das Bloßstellen vor versammelter Mannschaft oder die Vermischung beruflicher und privater Interessen. In der Politik und Wirtschaft fallen Brandmauern zwischen demokratischen und extremistischen Parteien bzw. zwischen dem einem Unternehmen und unseriösen Lieferanten, weil aus angeblichen Sachzwängen heraus die Akteure zusammenarbeiten müssen. Ein Tabubruch gegen diese zum Teil nicht schriftlich dokumentierten, aber bekannten Regeln löst nicht nur Empörung aus, sondern ist Ausdruck für das Brechen eines Markenversprechens. Dennoch gehen Politiker und Unternehmen immer wieder das Risiko eines Tabubruchs ein, weil sie sich damit einen Wettbewerbsvorteil erhoffen, der höher zu sein scheint als die sozialen und ökonomischen Kosten. Tabuthemen können zudem Triggerpunkte sein, wenn sie ein hohes Eskalationspotential besitzen.
Trigger
Auslöser einer Krise oder eines Stimmungswandels, oft ein einzelner kleiner Vorfall, der größere Prozesse in Gang setzt.
Unsicherheit
Eine Situation, in der die Ergebnisse und Konsequenzen einer Handlung oder eines Ereignisses nicht vorhergesagt werden kann. Je komplexer und dynamischer unsere Welt wird, desto seltener werden sichere Entscheidungsgrundlagen. Die Unsicherheit wird zur neuen Normalität und unterscheidet sich klar vom Risiko, bei dem die Eintrittswahrscheinlichkeit eines kritischen Ereignisses angegeben werden kann. Umso wichtiger werden flexible Strategien inklusive Rückfallpositionen bzw. Betriebsersatzlösungen auf der Basis verschiedener Szenarien sowie das permanente Hinterfragen der Planungsprämissen und Fakten.
Ursachenanalyse
Identifikation des Ausgangspunkts einer Krise.
Vertrauenslücke
Diskrepanz zwischen dem, was Organisationen kommunizieren, und dem, was Stakeholder ihnen glauben – häufig verschärfend in Krisen.
Vor die Lage kommen
Der Ausdruck wurde ursprünglich vom Militär, der Polizei und der Feuerwehr verwendet. Gemeint ist damit ein aktives und vorausschauendes Handeln, statt nur auf Krisen oder Probleme nachträglich zu reagieren. Hierfür reicht es nicht, ein elektronisches Frühwarnsystem zu haben. Vielmehr bedarf es hierzu einer allgemeinen Wachsamkeit und die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. Fehler und Risiken (auch bei einem bereits eingetretenen Ereignis) sind frei von Ängsten und willkürlichen Filterprozessen zu melden und objektiv zu bewerten. Je eher mögliche Probleme und Krisen antizipiert werden, desto geringer wird das Risiko einer Eskalation, die sich aus dem Überraschungsmoment einer Krise ergibt.
Voxpops
Voxpops (Kurzform von lateinisch Vox populi – “Stimme des Volkes”) ist ein Medienformat, bei dem zufällig ausgewählte Passanten zu einem Thema befragt werden. Die gesammelten Aussagen werden dann in kurzen Clips aneinandergeschnitten und als «Vox pop»-Beitrag veröffentlicht.
VUCA
VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Diese Begriffe beschreiben die allgemeinen Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen Emtscheidungen treffen müssen.
Whistleblower-Management
Umgang mit internen Hinweisgebern.
Witwenschütteln
Rücksichtslose Interviewtechnik von Journalisten, um an Bilder und Informationen insbesondere von den Hinterbliebenen eines Unglücksopfers zu gelangen. Ziel der Medien ist, so schnell wie möglich emotional aufgeladene Schlagzeilen zu veröffentlichen.
Worst Case
Aufgabe des Krisenmanagements ist es, auch das Undenkbare zu denken, bevor es eintritt. Im Rahmen einer Szenarioanalyse werden verschiedenste „Was wäre wenn?“ Fragen gestellt und die sich hieraus ergebenden Zukunftssituationen abgeleitet. Statt nur vom bestmöglichen Fall auszugehen (Best Case), müssen Unternehmen sagen können, wie sie sich auch gegen den schlimmstmöglichen Fall (Worst Case) vorbereiten bzw. bei dessen Eintreten reagieren werden. Da jeder Mensch für seinen eigenen Bereich einen blinden Fleck aufweist, sollte für die Szenarioplanung besser ein unabhängiger Experte herangezogen werden.
Xenophobie
Xenophobie steht für Fremdenfeindlichkeit. In der Geschichte menschlicher Krisen nehmen Fremde bis heute oft die undankbare und ungerechtfertigte Rolle eines Sündenbocks ein. Statt die wahren Ursachen und die eigene Verantwortung für eine Krise zu untersuchen, wird die Aufmerksamkeit stellvertretend auf Personen bzw. Gruppen übertragen, deren Ursprung nicht im eigenen Land oder Unternehmen liegt. Die kurzfristige Erleichterung für die Einheimischen bzw. Betriebsangehörigen wird mit einer sehr wahrscheinlichen Rückkehr der Probleme und einem Verlust der eigenen Innovationskultur erkauft. Darüber hinaus zerstört Xenophobie den Zusammenhalt einer Kultur.
Yellow Press
Yellow Press Journalisten bzw. Boulevardmedien suchen Emotionen, Schuldige und Skandale. Ihre beliebtesten Aufregerthemen sind Sex, Drugs und Crime, weil diese regelmäßig hohe Auflagen und Einschaltquoten versprechen. Daraus stammt der mediale Grundsatz: „Bad News are good News.“ Nicht alle Redakteure gehören der Yellow Press an. Daher sollten Unternehmen, die sich von einem Presseveriss bedroht sehen, auf allgemeines Journalisten-Bashing verzichten. Medienvertreter nehmen eine wichtige Informationsaufgabe in unserer Gesellschaft ein und bedienen einen von den Konsumenten nachgefragten Bedarf. Anfragen von Journalisten (egal, ob sich um Yellow Press, Lokalredaktionen oder investigative Medien handelt) machen zuerst einmal ihren Job und sehen in den Sprechern eines Unternehmens eine mehr oder weniger verlässliche Quelle. Die Erfahrung zeigt, dass die Ursache kritischer Berichterstattung auch im Verhalten der Kommunikatoren zu suchen ist. Getreu dem Satz: „It takes two to tango.“
Zielgruppenstress
Der Umstand, dass Stakeholder in Krisen emotional überlastet sind und daher anders wahrnehmen, denken und reagieren als gewohnt.
Zögerlichkeit
Krisenmanagement und Krisenmanagement erfordern regelmäßig akute Sofortmaßnahmen. Statt Perfektion geht es darum, als erster die Deutungshoheit über eine Krise zu erlangen. So beschränkt sich eine Erstmeldung auf die chronologische Beschreibung der Daten, die bislang vorliegen. Erklärungen, Rechtfertigungen oder professionelles Bildmaterial sind nebensächlich bzw. kontraproduktiv. Neben der permanenten Erreichbarkeit des Bereitschaftsdienstes bzw. einer Notfall-Hotline, müssen Kommunikatoren so schnell wie möglich sprechbereit sein. Kamen früher durch Blaulichtreporter nach etwa 30 Minuten die ersten Radiomeldungen, so setzen inzwischen soziale Medien den Frame bzw. Deutungsrahmen eines Ereignisses in Echtzeit. Aus strategischer Sicht begegnen wir der Zögerlichkeit auch dann, wenn das Wissen über die Zusammenhänge einer Krise scheibchenweise nach einer „Salamitaktik“ verkündet wird. Dabei wäre es fast immer besser nach dem Motto zu kommunizieren: „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“