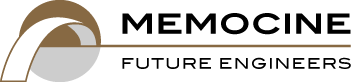Sorry: Die Kunst der Entschuldigung
Warum fallen uns Entschuldigungen so schwer? Wie sollten sich Unternehmen und Manager für begangene Fehler und Krisen entschuldigen?
Zwei verschiedene Welten von Entschuldigungen: Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen entschuldigt sich bei allen grönländischen Frauen, die um ihren Lebenstraum eigener Kinder beraubt wurden. In den 60er Jahren hatten dänische Ärzte ihren Patientinnen ohne deren Kenntnis und Einverständnis Spiralen eingesetzt. 4.000 Kilometer entfernt rechtfertigt derweil der Bayerische Ministerpräsident Söder in einer Podiumsdiskussion seinen sexistischen Vergleich der deutschen Wirtschaft ohne Industrie mit „einer Frau ohne Unterleib“. So hätte er lediglich ein altes deutsches Sprichwort benutzt, das einer jungen Kritikerin aus dem Publikum offenbar nicht bekannt sei.
Bereits Kleinkindern bringen wir bei, wie sie sich nicht nur artig zu bedanken haben, sondern dass sie sich nach einem Fehler entschuldigen sollen. Schnell lernen sie, dass diese Spielregeln für Erwachsene nicht zu gelten scheinen. Im Gegenteil. Wer weniger oft das Wort „Sorry“ ausspricht, wird in unserer schnelllebigen Zeit als führungs- und durchsetzungsstark wahrgenommen und befördert. Ein durch Unrecht verursachtes Problem wird dadurch jedoch nicht gelöst, sondern höchstens aufgeschoben.
Entschuldigungen haben eine vermittelnde Funktion. „Ich versetze mich in dich hinein. Ich spüre, dass ich etwas getan habe, was dich verletzt hat, was dich gekränkt hat. Ich habe das erkannt und ich bedaure dies.” So definiert es der Paartherapeut Hans-Georg Lauer. Worauf müssen die Verantwortlichen achten, wenn ein Unternehmen bzw. eine Organisation sich entschuldigen will?
Warum fällt uns eine Entschuldigung so schwer?
„Wer sich verteidigt, klagt sich an.“ Eng verbunden mit diesem weit verbreiteten Mindset ist die Vorstellung, dass eine Entschuldigung gleichbedeutend sei mit einem Schuldanerkenntnis, dem automatisch Schadensersatzforderungen folgen könnten. Leider schweigen viele Menschen ausgerechnet in Momenten, in denen es um Empathie geht und nicht um das eigene Ego. Aus diesem Grunde änderte der Gesetzgeber im Jahr 2008 das Versicherungsvertragsgesetz. „Vertragsklauseln, die die Versicherungen wegen eines Schuldanerkenntnisses von der Leistungspflicht befreien, sind hinfällig, selbst wenn sie in Ihrem Vertrag stehen, so haben sie keine Gültigkeit.“ Diese Regelung bezieht sich nicht nur auf ärztliche Behandlungsfehler, sondern grundsätzlich auf Versicherungsverträge (z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Berufshaftpflicht- oder Berufsunfähigkeitsversicherung).
Gerichte haben längst entschieden, dass in sensiblen Krisensituationen menschliches Mitgefühl als Ausdruck des Bedauerns eines Fehlers nicht als deklaratorisches Schuldeingeständnis gewertet werden dürfen. Eine Entschuldigung erinnert uns daran, dass wir alle Menschen sind. Und Menschen machen Fehler. Rechtliche Fragen nach Fahrlässigkeit oder Vorsatz, nach Schuld und Sühne müssen getrennt davon beantwortet werden. Die Beweislast für das Geltendmachen eines Anspruches bleibt beim Kläger. Eine Entschuldigung kann jedoch die Basis für die Befriedung eines Streits oder eines außergerichtlichen Vergleichs liefern.
Drei Strategien von Entschuldigungen
Nicht jede Entschuldigung muss als „Gang nach Canossa“ enden, wie es König Heinrich IV. im Jahr 1077 widerfuhr. Der Monarch war durch einen Kompetenzstreit mit dem Papst von diesem exkommuniziert worden. Drei Tage lang wartete Heinrich barfuß und im Büßergewand vor den Burgmauern, bis das Kirchenoberhaupt endlich die Tore öffnete und die Exkommunikation wieder aufhebte. Auch ohne diese Dramatik finden sich im Business drei wiederkehrende Typen von Entschuldigungsstrategien:
- Entschuldigung als Pflichtkommunikation: Im Fokus steht die Beschreibung eines kollektiv empfundenen Gefühls, um Sprechbereitschaft zu signalisieren. So wird vermieden, dass Medien sagen: „Das Unternehmen war zu einer Stellungnahme nicht bereit.“ Außer schmallippigen Plattitüden darf niemand erwarten, dass den Worten auch Taten oder ein nachhaltiger Dialog mit den Betroffenen folgen. Personen mit Sprecherfunktionen wird ein Maulkorb umgehängt. Am Ende wirken die Worte wie ein „Sorry, Shit happens!“
- Beschwichtigung und Deeskalation: Bei dieser Kommunikationsstrategie fällt auf, dass die Partei, die sich entschuldigt, sichtbar Hierarchien zu den Betroffenen abbauen will. Abweichend von dem normalen, souveränen Auftritt wirkt das Unternehmen und sein Management plötzlich verletzlich. Dadurch wird aktiv das Narrativ der Kritiker vom Kampf „David gegen Goliath“ relativiert und eine öffentliche Beißhemmung aufgebaut. Darüber hinaus vermisst man leider auch hier konkrete Ankündigungen für Lessons Learned und ein verändertes Verhalten. Dadurch wirkt diese Strategie regelmäßig wie ein Spiel auf Zeit, bis das öffentliche Interesse verschwindet.
- Ehrliche Entschuldigung: Im Gegensatz zu den obigen Relativierungen, Rechtfertigungen, Ablenkungen und Spiel auf Zeit setzt sich das Unternehmen ernsthaft und authentisch mit dem Konflikt auseinander. Die Kernbotschaft einer ehrlichen Entschuldigung besteht aus drei Elementen: „Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Wie kann ich es wieder gutmachen?“ Gerade der letzte Punkt könnte jedoch dazu führen, dass Manager vor dem eigenen Mut wieder einknicken. Dabei lebt Ehrlichkeit davon, dass die Konsequenzen angenommen werden. Ohne Wenn und Aber.
Blaupause für Entschuldigungen
Jeder Konflikt verdient eine maßgeschneiderte Lösung und bei Bedarf eine wohl durchdachte Entschuldigung. In seiner Studie „An Exploration of the Structure of Effective Apologies” aus dem Jahr 2016 beschreibt der Sozialpsychologe und Experte für Wirtschaftsethik Roy Lewicki die Anatomie einer erfolgreichen Entschuldigung:
- Ausdruck von Bedauern
- Erklärung, was falsch gemacht wurde
- Aufsichnehmen der Verantwortung
- Bekunden von Reue
- Angebot der Wiedergutmachung
- Bitte um Verzeihung
Ein Beispiel:
Ausdruck von Bedauern
„Es tut mir sehr leid, dass meine Worte gestern im Meeting Sie verletzt haben.“
Erklärung, was falsch gemacht wurde
„Ich habe die Situation falsch eingeschätzt und meine Kritik in einer Weise geäußert, die unangebracht und verletzend war.“
Auf-sich-Nehmen der Verantwortung
„Es war allein meine Entscheidung, so zu sprechen, und niemand anderes trägt die Schuld dafür.“
Bekunden von Reue
„Ich bedaure aufrichtig, dass ich damit Ihr Vertrauen und unser gutes Arbeitsverhältnis belastet habe.“
Angebot der Wiedergutmachung
„Gern möchte ich den Schaden wiedergutmachen, indem ich unser Missverständnis persönlich kläre und dafür sorge, dass so etwas künftig nicht mehr passiert.“
Bitte um Verzeihung
„Ich hoffe sehr, dass Sie mir diesen Fehler verzeihen können.“
Und wenn die Entschuldigung nicht angenommen wird?
Sich zu entschuldigen ist Kunst und Handwerk gleichermaßen. Dabei gilt der Grundsatz: „Wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht.“ D.h. nicht das Unternehmen und sein Management, das möglicherweise für einen Fehler verantwortlich ist, kann sich selbst entschuldigen bzw. exkulpieren. Es kommt auf die Betroffenen an, ob diese die Entschuldigung als angemessen und glaubwürdig ansehen. So erinnern sich viele Menschen positiv an den Kniefall von Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Mahnmal des Warschauer Gettos. Was in Deutschland bis heute als große politische Geste der Versöhnung gedeutet wird, findet in Polen bei weitem nicht die gleiche Resonanz, was sich immer wieder u.a. in polnischen Reparationsforderungen manifestiert. Wer sich also entschuldigt, muss akzeptieren, dass eine ausgestreckte Hand nicht sofort ergriffen wird. Umso wichtiger wird es nach einem Entschuldigungs-Statement genau zuzuhören, ohne sich reflexartig zu rechtfertigen.
Mediale Vorbereitung auf die Entschuldigung eines Unternehmens
Die öffentliche Entschuldigung eines Unternehmens und seines Managements sollte gut vorbereitet werden. Um eigene Impulsivität, Ängste und taktische Spielchen der Verantwortlichen zu vermeiden, sollte sich bei der Entscheidungsfindung unabhängig begleiten lassen. Typische interne Vorbereitungsfragen sind u.a.:
- Warum sollte sich das Unternehmen entschuldigen und was ist das Kommunikationsziel?
- Was ist der inhaltliche Gegenstand der Entschuldigung und was nicht?
- Wann soll die Entschuldigung erfolgen bzw. was ist das richtige Timing?
- Wo und wem gegenüber soll die Entschuldigung ausgesprochen werden?
- Wer entschuldigt sich stellvertretend für das Unternehmen?
- Wie soll die Entschuldigung kommuniziert werden?
- Wie soll das Unternehmen reagieren, wenn die Entschuldigung nicht angenommen wird?
- Wie soll die eigene Glaubwürdigkeit nachgewiesen werden? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Entschuldigung etc. …?
Darüber hinaus zieht jede Entschuldigung eine Reihe externer Fragen nach sich, die als FAQ-Liste prophylaktisch vorbereitet und später auch mit Leben gefüllt werden muss (Beispiele):
- Warum entschuldigen Sie sich jetzt und nicht früher?
- Was genau ist schiefgelaufen? Können Sie den Fehler konkret benennen?
- Wer trägt die Verantwortung für den Vorfall? Sind Konsequenzen für Verantwortliche geplant?
- Gab es interne Warnungen oder Hinweise, die ignoriert wurden?
- Welche Rolle haben Sie persönlich in dem Fall gespielt?
- Ist Ihre Entschuldigung freiwillig oder nur wegen öffentlichen Drucks erfolgt?
- Wie verhindern Sie, dass so etwas erneut passiert?
- Wie gehen Sie mit möglicher finanzieller Haftung um? Haben Sie hierfür einen ausreichenden Versicherungsschutz?
- Wie reagieren Ihre Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner auf die Entschuldigung etc. …?
Entschuldigungen erfordern Haltung. Nur wer Größe besitzt, ist dazu in der Lage. Als Lohn für diese Entscheidung erwartet nicht nur die Betroffenen, sondern auch diejenigen, die um Entschuldigung bitten, ein Neustart und die Chance, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.
Ihr Unternehmen befindet sich in einem Konflikt bzw. einer Krise und Sie wollen mit einer Entschuldigung auf die Betroffenen zugehen? Gerne begleitet MEMOCINE Sie und Ihr Team vertrauensvoll bei allen dafür notwendigen Kommunikationsmaßnahmen.