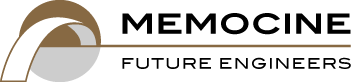Krisenkommunikation bei Boykottkampagnen
Kritische Stakeholder rufen dazu auf, keine weiteren Produkte von Ihrem Unternehmen zu kaufen? Hier ist eine Liste an Erste-Hilfe-Maßnahmen für Krisenkommunikation und Krisenmanagement.
Das Wesen eines Boykotts verstehen
Wir leben in einer Zeit, in der von jetzt auf sofort die Kommunikation zwischen zwei Parteien komplett abbrechen kann. Dies gilt nicht nur für das moderne „Schlussmachen von Paaren“ via Smartphone. Unternehmen werden nicht nur an den Online-Pranger gestellt; sie werden “geächtet” und aus der Gemeinschaft ausgestoßen, indem man ihnen neben dem guten Ruf auch die Geschäftsgrundlage entzieht. Für Firmen kann diese extreme Form des Protestes mit erheblichen materiellen und immateriellen Schäden verknüpft sein. Und zwar nachhaltig, denn ein Boykott ist mehr als nur ein impulsiver Kontaktabbruch. Er impliziert eine signifikante, nachhaltige Einstellungsänderung gegenüber Unternehmen sowie deren Angeboten und Menschen. Treffen kann es jeden und alles, was für den Boykotteur zum Gegenpol der eigenen Positionen geworden ist. Drei prominente Beispiele aus der Krisenkommunikation:
- 1995 rief Greenpeace insbesondere deutsche Konsumenten zu einer Boykott-Kampagne von Shell-Tankstellen auf, nachdem der niederländische Mineralölkonzern die ausrangierte Erdölplattform Brent Spar im Atlantik versenken wollte. Der Umsatz brach laut Experten zeitweise um mindestens 30% ein. Das Boykott-Verhalten wurde erst aufgehoben, als das Unternehmen ankündigte, seine geplante Aktion im Meer zu stoppen. Der Reputationsschaden blieb allerdings noch länger bestehen.
- 2005 veröffentlichte die dänische Zeitung Jyllands-Posten zwölf Karikaturen über den Propheten Mohammed. Viele Muslime fühlten sich mit ihrem Glauben beleidigt und riefen zu Protesten in über 50 muslimischen Ländern Zeitgleich wurden dänische Produkte von den muslimischen Händlern aus den Regalen geräumt. Betroffen waren u.a. Marken wie Arla Foods mit ihren dänischen Molkereiprodukten, die Biermarke Carlsberg (zumindest im Libanon und in der Türkei) und u.a. auch die Weltmarke Lego. Die ebenfalls von dem Boykott benachteiligte Firma Nestlé sah sich gezwungen, auf ganzseitigen, arabischen Zeitungsanzeigen zu erklären, dass der Firmenname schweizerischen und nicht dänischen Ursprungs sei. Nach etwa 4 Monaten ebbte der Boykott langsam ab, nachdem sich die dänische Regierung und die Vereinten Nationen um eine diplomatische Lösung bemüht hatten.
- 2025 hat der Zollkrieg des US-Präsidenten Donald Trump gegen den eigenen größten Handelspartner Kanada einen gigantischen Boykott gegen US-Produkten und Dienstleistungen ausgelöst, den es in der gemeinsamen Wirtschaftsgeschichte beider Länder so noch nicht gegeben hat. Mit Kampagnen wie „Buy Canadian“ oder #BoycottUSA in sozialen Medien rufen die Kritiker zur Unterstützung der eigenen, kanadischen Wirtschaft auf. Der erwartete Rückgang beider Volkswirtschaften wird am Ende des Tages Kanada voraussichtlich 20 Mrd. Kanadische Dollar und die Vereinigten Staaten 108 Mrd. US-Dollar kosten. Der finale Ausgang steht noch offen.
Boykotts prophylaktisch voraussehen
Wer an dieser Stelle meint, dass ihn und seine Firma ein Boykott nicht treffen könnte, der sollte dennoch prophylaktisch über folgende Risikopotenziale nachdenken:
- Wertekonflikte und Identitätspolitik
Positionierungen zu Themen wie Gender, LGBTQ+, religiöse Symbolik oder politische Statements (z. B. rund um „Pride Month“, Black Lives Matter oder Trans-Rechte) können breite Unterstützung, aber auch massiven Widerstand auslösen, etwa durch Vorwürfe der „Wokeness“ oder des „Pinkwashing“. - Umgang mit geopolitischen Krisen
In einer multipolaren Welt erwarten Stakeholder Haltung zu Krieg, Besatzung, Diktaturen oder Menschenrechten. Schweigen kann als Zustimmung gewertet werden, Positionierung als Parteinahme. Ein bekanntes Beispiel: westliche Marken in Russland oder China. - Arbeitsbedingungen & Lieferkettenethik
Skandale um Ausbeutung, Kinderarbeit, prekäre Löhne oder schlechte Arbeitsbedingungen (auch indirekt über Zulieferer) führen oft zu Boykottdruck, insbesondere bei Textil-, Tech- oder Lebensmittelmarken. - Klimaverfehlungen und Greenwashing
Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Imagefaktor; sie wird moralisch bewertet. Unzureichende Maßnahmen, leere Versprechen oder überzogene Werbeaussagen („Green Claims“) können aktivistische Gegenkampagnen und Konsumverweigerung auslösen. Dabei kann die Eskalation auch vor Gericht landen. - Fehltritte in der Unternehmenskommunikation
Werbung, Social Media oder CEO-Statements können (gewollt oder unbeabsichtigt) gesellschaftliche Gruppen verletzen oder polarisieren. Ein unbedachter Post reicht, um ein Unternehmen zur Zielscheibe zu machen.
Sieben Phasen einer Boykottkampagne
Wurden die schwachen Signale einer akut gestörten Stakeholder-Beziehung nicht erkannt (z.B. durch das Ignorieren einzelner Beschwerden, einem Ausbleiben von Feedbacks bei bestehenden Dialogen oder die aktive Suche des Gegenübers nach alternativen Produkten und Partnern), durchlaufen Unternehmen einen aus sieben Phasen bestehenden Leidensweg:
- Auslöser & Initialzündung
Ein konkreter Anlass entfacht den Protest: eine Werbung, eine Aussage, ein Produkt, ein politisches Statement oder auch das Weglassen eines solchen.
- Mobilisierung & Empörungsdynamik
Aktivisten, Influencer oder Communities greifen das Thema auf. Erste Boykottaufrufe entstehen, begleitet von Empörung, Bewertungen und medialer Aufmerksamkeit. All dies schaukelt sich immer weiter auf.
- Verdichtung & Reichweitensprung
Der Boykott erreicht die breite Öffentlichkeit. Medien berichten, Stakeholder reagieren, das Thema entwickelt eine Eigendynamik, welche das Unternehmen nicht ad hoc einfangen kann und so zumindest temporär in die Defensive gerät.
- Polarisierung & Eskalation
Die Fronten verhärten sich. Es bilden sich Pro- und Contra-Lager. Unternehmen sehen sich in einer unangenehmen „Sandwich-Position“ wieder: von Kritikern aber auch bisherigen Unterstützern, die an dem Unternehmen zu zweifeln anfangen. In dieser Phase ist nicht die Eskalation entscheidend, sondern wie das Unternehmen mit ihr umgeht.
- Dialog & Wendepunkt
Ein Wendepunkt kann eintreten durch glaubwürdige Kommunikation, externe Vermittlung oder politische Intervention. Entweder beginnt ein Dialog oder der Boykott radikalisiert sich; der Trotz und die Blockadehaltung gewinnen die Oberhand.
- Abkühlung & Normalisierung
Das öffentliche Interesse lässt nach. Die Aktion verliert ihr Momentum oder verlagert sich auf andere Themen. Dies bedeutet jedoch noch lange nicht, dass ein zuvor eingetretener Imageschaden automatisch als geheilt gilt.
- Nachwirkungen & Reputationsfolgen
Die Kampagne hinterlässt Spuren. Umsatzverluste werden sichtbar, das Kundenverhalten wird langfristig an den bisherigen Krisenverlauf adaptiert, Personen in Schlüsselpositionen können unter Umständen ausgetauscht werden. Die betroffenen Unternehmen müssen nun rasch nacharbeiten: strukturell, kommunikativ und auch kulturell, um einen nachhaltigen Stakeholder-Dialog zu ermöglichen.
Typische Kommunikationsfehler nach einem Boykott
Leider verlaufen solche Boykottkampagnen selten nach einem perfekten Drehbuch. Wenn ein Boykott für die nachhaltige Störung einer Beziehung steht, dann reicht es nicht aus, einen offensichtlichen Fehler zu bereinigen oder sich zu entschuldigen. Vielmehr bedarf es überproportional viel Zeit, um ein einmal verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Beruflich wie privat.
Erschwert wird diese Aufgabe regelmäßig durch wiederkehrende Kommunikationsfehler in der Boykottphase:
- Schweigen statt Handeln: Persönliche Kränkungen wie auch die persönliche Überraschung hinsichtlich der Dimension des Boykotts verleiten die betroffenen Unternehmen zum Schweigen. Niemand möchte etwas falsch sagen. Der Kommunikationsabteilung wird prophylaktisch ein Maulkorb umgehängt. Dringende Fragen werden so nicht beantwortet bzw. die Deutungshoheit der Gegenseite überlassen.
- Kommunikationsvakuum durch Machspielchen: Um sich für mögliche Verhandlungen nicht zu früh festzulegen, werden kritische Stimmen pauschal abgewiegelt. Teils übernehmen in diesem Kommunikationsvakuum die „Wadenbeißer“ die Deutungshoheit. Deren Arroganz und Aggressivität mag für den einen oder anderen Manager eine willkommene Solidaritätsbekundung sein. Tatsächlich aber wird durch deren Extrempositionen eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt.
- Uneinheitliche Tonalität: Um Vertrauen zurückzugewinnen, muss das Unternehmen mit einer Stimme sprechen. Das bei Verhandlungen gerne eingesetzte Rollenmodell des „bad guy – good guy“ wirkt stattdessen wie ein Brandbeschleuniger. Besser wäre es, auf bewährte Instrumente der Mediation und Streitschlichtung zurückzugreifen.
- Eskalation durch Symbolpolitik: Wer den Boykott unbedingt zu einer Never-ending-story machen will, um Recht zu behalten, der sollte Öffentlichkeit und Kritiker mit falschen Versprechen, Scheindebatten und Ablenkungsmanövern in die Irre leiten. Wer diesen Weg einschlägt, zeigt, dass er bzw. sie sehr wahrscheinlich die eigentliche Ursache für die Auseinandersetzung sein könnte. In der Politik finden sich leider eine Vielzahl abschreckender Beispiele für diese Symbolpolitik.
Warnung: Umso wichtiger ist es, dass Personen, die von einem solchen Streit persönlich betroffen sind, sich Hilfe von außen holen. Unter Stress stehende Menschen verstärken ihren Tunnelblick und sind nicht in der Lage mögliche Zusammenhänge, Abhängigkeiten, Interessenkonflikte, Befangenheiten und rote Linien zu erkennen.
Krisenkommunikationsstrategie und KOM-Instrumente gegen Boykottaufrufe
Was also können Unternehmen in einer solchen Situation besser machen?
Zunächst einmal muss das Unternehmen feststellen, ob es eine Verteidigungs- oder Angriffsstrategie (auch im Sinne eines Gegenangriffs) verfolgen will bzw. kann. Ist die Kritik berechtigt, sollte das Eingestehen des eigenen Fehlers nicht nach der Salamitaktik scheibchenweise erfolgen. Wer Vertrauen zurückgewinnen will, muss unmissverständlich Haltung zeigen und nach einem Dreiklang sein Statement vorbereiten:
- „Wir haben einen Fehler begangen…
- Es tut uns leid…
- Wie können wir es wieder gut machen…?
Wurden die Boykott-Vorwürfe zu Unrecht erhoben oder bestehen Missverständnisse, so bedarf es einer sachlichen Richtigstellung auf Basis eines unabhängigen Faktenchecks. Und ohne Polemik. Die Formulierung einer abweichenden Meinung oder die Suche nach „alternativen Fakten“ sind dagegen NICHT Teil der Lösung.
Bei unklarer Sachlage wird sehr wahrscheinlich eine Verzögerungsstrategie die zweckmäßige Reaktion sein, um dabei zuerst einmal auf Zeit zu spielen, bis ein Kommunikationskanal zu den Boykotteuren aufgebaut werden konnte. Sobald dies erfolgt ist, können beide Seiten ein Time-out bzw. eine „Feuerpause“ für die Aktionen ihrer eigenen Unterstützer vereinbaren.
Zu den operativen Kommunikations-Instrumenten zählen:
Das Big Picture – mehr als nur ein Monitoring
Um sichere Entscheidungen zu treffen und typische Kommunikationsfehler zu vermeiden, braucht es ein ganzheitliches Lagebild: „Wer hat wann, wo, was, warum gesagt oder getan?“ Was sind schmerzhafte Symptome eines Boykotts und was könnten die tiefer liegenden Ursachen sein?
Kritiker positionieren sich oft als David im Kampf gegen Goliath. Diese Story wird mit emotionalen und plakativen Bildern untermalt. Wer hierzu ein wirksames Gegen-Narrativ aufzeichnen will, braucht belastbare Fakten. Nicht immer gelingt es den betroffenen Unternehmen, eine Beweislast umzukehren und sich selbst als Opfer darzustellen. Der Teufel steckt oft im Detail. Daher noch einmal der Grundsatz: Bevor eine Strategie entschieden wird, muss zuerst das Risiko und der Impact des Boykotts bewertet werden!
First Aid Kommunikation
Falls sich nach einem offensichtlichen Fauxpas, dem eine chronische Missachtung einer Stakeholder-Beziehung vorherging, noch kein klares Lagebild ergibt, so muss das Unternehmen dennoch sprechbereit sein.
- Faktisch – was ist passiert?
- Empathisch – wer ist betroffen?
- Lösungsorientiert – was tun wir?
Statt einer persönlichen Bewertung empfiehlt es sich nur zu beschreiben, was in chronologischer Reihenfolge passiert ist und welche Next Steps geplant sind. Dazu gehört als Kernbotschaft die Ankündigung, dass man das Gespräch mit den Kritikern sucht, um Fragen zu stellen und ihnen zuerst einmal zuzuhören. Die Drohung, einen Dialog platzen zu lassen, wirkt stattdessen selten souverän.
Rotes Telefon
Während des Kalten Krieges gab es eine feste Telefonverbindung zwischen Washington und Moskau. Wann immer eine mögliche Eskalation drohte, unterrichtete man sich gegenseitig. Entsprechend brauchen Unternehmen auch heute robuste Kommunikationskanäle: vom Telefonat, über den Jour fixe via Video Call bis zum persönlichen Treffen an einem geschützten Ort des Vertrauens. Darüber hinaus steht das rote Telefon für die Suche nach einer langfristigen Begegnungs- und Dialogplattform zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern. Nur so lässt sich Vertrauen langfristig wiederherstellen.
Stakeholder Management
Es gilt der Grundsatz: „Freunde sollte dicht bei sich haben, Feinde muss man noch enger an sich binden.“ Je massiver die Kritik der Boykotteure ist, desto mehr wird möglicherweise die Aufmerksamkeit des Krisenstabes von den Interessen anderer Zielgruppen abgelenkt. Dennoch müssen auch Kunden, Lieferanten, die Medien, Shareholder und andere Personen über den Status quo und mögliche Lösungswege informiert werden. Letzteres ermöglicht bei Bedarf „das Spiel über Bande: eine indirekte Kommunikation über Dritte. D.h. statt sich persönlich um Kopf und Kragen zu reden, können andere Stakeholder stellvertretend für das Unternehmen bzw. die Organisation wichtige Argumente ins Feld führen. Gerade Wissenschaftlern und unabhängigen Gutachtern fällt hierbei oft eine streitschlichtende Funktion zu.
Verhandlungspsychologie und Streitschlichtung
Statt Schuldzuweisungen braucht es gezielte Techniken: aktives Zuhören, interessenbasierte Gesprächsführung und der bewusste Verzicht auf Eskalationsrhetorik schaffen eine neue Gesprächsbasis. Externe Mediatoren oder Streitschlichter können dabei helfen, verhärtete Fronten zu lösen. Und zwar ohne Gesichtsverlust für die Beteiligten.
Social Media als Kommunikationshebel
Der „Erfolg“ eines Boykotts lebt vom Mitmachen und Nachahmen durch die eigene Community. Entsprechend braucht eine Kampagne Mitstreiter. Diese finden sich schnell und preisgünstig vor allem in sozialen Medien. Mit dieser Erkenntnis aus der Perspektive der Aktivisten erklärt sich, dass auch die betroffenen Unternehmen die Themenentwicklung primär in Social Media aktiv begleiten müssen: von der Platzierung einer eigenen Stellungnahme, der Bereitstellung von Fakten, das Korrigieren von Fake News, über die Einladung befreundeter Mitstreiter bis zur Ergreifung rechtlicher Schutzmaßnahmen als Ultima Ratio.
Interne Kommunikation als Balance of Power
Die Belegschaft erfährt von einem Boykott oft erst aus den Medien. Dabei wäre es umso wichtiger, dass das Management proaktiv mittels Town-Hall-Meeting, Rundbrief und auch Sprachregelungen für Personen mit Sprechfunktion bzw. Kundenkontakt Unterstützung und Orientierung anbietet. Wer hier eine offene, transparente Kommunikationskultur vorlebt, der kann zu möglichen Bürgerinformationsveranstaltungen auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Unterstützer schicken.
Denken in Boykottphasen – vom Frühwarnsystem bis zur Post-Krisenkommunikation
Ein Boykott tritt nur scheinbar plötzlich auf. Vielmehr kündigt er sich durch eine Vielzahl kleiner und großer Warnsignale an, bis es zum Big Bang kommt. Umso wichtiger ist ein Issue Monitoring, mit dem kritische Themen und deren Opinion Leaders aufmerksam beobachtet werden. Aber aufpassen, dass das Sammeln von Informationen datenschutzkonform bleibt!
In der akuten Phase dominiert das aus der Krisenkommunikation bekannte Instrumentarium. Leider findet die nach einem akuten Boykott notwendige Post-Krisenkommunikation bzw. das Reputation Management zu wenig Beachtung. Wie bereits dargelegt, geht es nicht um Symbolpolitik und Alibi-Versprechen. Beide Parteien müssen gemeinsam herausfinden, was die Lessons learned aus einem Boykott waren und wie man eine Wiederholung der Krise in der Zukunft verhindern kann.
Litigation-PR
Jeder darf auf Missstände Dritter hinweisen und zu einem kritischem Konsumverhalten aufrufen, solange dies den Fakten entspricht. Nicht alles aber, was Boykotteure sagen und tun, ist zulässig. Richtig ist, dass ein Boykottaufruf zunächst einmal durch die Meinungsfeiheit gedeckt ist. Nicht erlaubt ist jedoch die sittenwidrige, vorsätzliche Schädigung (z.B. durch eine Boykottkampagne, für die es keinerlei Rechtfertigung gibt). Falsche Tatsachenbehauptungen und ehrverletztende Aussagen können zu Unterlassungs- und Schadensersatzforderungen führen. Die üble Nachrede, Verleumdung und Nötigung (d.h. das gewaltsame Erzwingen einer Handlung mit Gewalt und Drohungen) sind keine Kavaliersdelikte und können sogar strafrechtliche Konsequenzen haben. Besonders vorsichtig mit Boykott-Aufrufen und gezielten Behinderungen sollten Konkurrenten sein, weil dies einen Verstoß nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb darstellen könnte. In all den genannten Fällen kommt es auf die enge Zusammenarbeit von Anwälten und Kommunikatoren an.
Fazit
Boykottaufrufe sind selten rein sachlich motiviert. Sie sind vielmehr Ausdruck eines tief gestörten Vertrauensverhältnisses. Wer in dieser Lage allein auf Fakten setzt, verkennt die emotionale Dynamik.
Verhandlungspsychologie und Streitschlichtung helfen, Konflikte nicht weiter zu verschärfen, sondern zu verstehen und konstruktiv zu verarbeiten.
Im Umgang mit Boykottaufrufen kann auf dieser Faktenlage das betroffene Unternehmen eine zweckmäßige Strategie und das dazugehörige Kommunikations-Mix wählen.
Schuldzuweisungen verlängern regelmäßig nur das Leiden. Stattdessen müssen beide Parteien (unabhängig von der Frage der Verantwortung) nach Wegen suchen, um über eine nachhaltige Dialogplattform das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Denn helfen kann man nur demjenigen, mit dem man spricht.
Ihrem Unternehmen droht ein Boykottaufruf bzw. der Dialog mit den kritischen Stakeholdern ist bereits nachhaltig beschädigt? Lassen Sie uns miteinander sprechen und gemeinsam nach wirksamen Problemlösungen suchen! Je eher, desto besser…